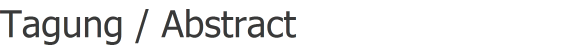19. bis 21. Februar / KulturBahnhof / Tagungszentrum
Tagung: Komik als Institution
Do / 19. Februar / 14 bis 17 Uhr
Thomas-Erik Junge, Bürgermeister und Kulturdezernent der Stadt Kassel
Begrüßung
Friedrich W. Block (Kassel)
Einführung
Es gibt eine große Zahl, womöglich eine wachsende Vielfalt von Formen sozialer und kultureller Ordnung, die ausdrücklich mit dem Begriff des Komischen bzw. denen der Komik oder des Humors verbunden werden. Das Komische als Institution zeigt sich unter anderem in Häusern (Beispiel Caricatura, Galerie und Museum f. Komische Kunst), Medienformaten (Beispiel Zeitschrift Titanic / TV Total), Gruppierungen (Neue Frankfurter Schule), Preisen (Kassler Literaturpreis für grotesken Humor, Göttinger Elch), Programmbegriffen ("Hochkomik", "Komische Kunst") oder auch Gattungen (Komödie, Witz, Satire, Comedy etc.) oder auch durch Personen bzw. Namen (Loriot, Emil, Gerhard Polt).
Dergleichen Phänomene lassen sich danach befragen, wie sie in sachlicher und zeitlicher Hinsicht organisiert sind, welche Begriffsbildungen, Werthaltungen, Strukturen und Funktionen sie ausbilden. Welche Bedeutung hat dies für die Gestaltung und Wirkung bzw. Aufnahme von Komik? Andererseits ist das Komische ein Medium, in dem man sich sensibel auf Institutionelles einstellen kann nicht zuletzt durch Subversion: Wie also spiegelt sich Institutionelles im Komischen? Und wie ist das Verhältnis von institutionalisierter zu solcher Komik, die gerade nicht gesellschaftlich, kulturell oder medial geordnet bzw. als solche ausgewiesen ist?
Alexander Brock (Halle)
Die stabile Instabilität. Zur Institutionalisierung des Komischen
Die zahlreichen Definitionsansätze für den Begriff "Institution" reichen von gesellschaftlichen Körperschaften bis hin zu konventionalisierten sprachlichen Strukturen. In Abhängigkeit vom so gewählten Blickwinkel erscheint auch das Verhältnis zwischen Institution und Komik unterschiedlich. Dies reflektieren Begriffspaare wie Ermöglichung – Erfüllung, Rahmung – Vollzug, Beschränkung – Durchbrechung, Stabilität – Instabilität, Erwartungssteuerung/Komikmaxime – Erwartungsbruch, Ordnung – Chaos usw.
In diesem Beitrag sollen die oben genannten Begriffspaare – basierend auf unterschiedlichen Institutionsdefinitionen – erläutert und damit das komplexe Verhältnis zwischen Institution und Komik umrissen werden. Hierzu werden Beispiele vor allem aus britischen Fernsehcomedies verwendet.
Anja Gerigk (München)
Jenseits der Komik – Diesseits des Sozialen
Die Reflexion des Gesellschaftlichen durch Komik findet meist im institutionalisierten Rahmen statt: in literarischen Gattungen, medialen Formaten, Rollenmustern und Inszenierungskonventionen. Dabei ist die Bandbreite zwischen Subversion, Sozialkritik und harmlosem Vergnügen besonders groß. Deshalb wird der Vortrag die Frage stellen, weshalb komische Kommunikation mit Institutionalisierung einhergeht: Wird sie dadurch ermöglicht, verstärkt oder entschärft? Beantworten lässt sich dies aufgrund eines neuen theoretischen Verständnisses: Hochkomik, im Unterschied zur Satire oder zum Witz, reflektiert die basalen Prozesse und Organisationsweisen des Sozialen. Dazu braucht sie nicht unbedingt feste Einrichtungen, ihr riskanter Umgang mit dem System Gesellschaft macht es aber ratsam, diese Art des Komischen einzuhegen und zu regulieren. Daraus folgt der Schluss: Weil sie radikal subversiv und überall möglich ist, wird Komik institutionalisiert, ihr größtes Verstörungs- und Reflexionspotenzial entfaltet sie außerhalb solcher Bindungen oder aber dadurch, dass sie ihre tiefer gehenden Absichten tarnt und sie im gesellschaftlich vereinbarten Rahmen von z.B. Komödie, Kabarett und Comedy erst recht verwirklicht.
Fr / 20. Februar / 10 bis 17 Uhr
Eckart Schörle (Erfurt)
Der Hofnarr. Aufstieg und Niedergang einer komischen Institution
Im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit waren Hofnarren selbstverständlicher Teil der höfischen Gesellschaft. Sie unterhielten sowohl die Fürsten als auch die übrigen Mitglieder des Hofes. Der Beitrag skizziert den Aufstieg des Narren zum amtlichen Spaßmacher und fragt nach Funktionen und Bedeutungen dieser komischen Institution in der Hofgesellschaft. Der Hofnarr war nicht nur Akteur und Komiker, sondern oftmals auch Gegenstand spöttischen Gelächters und Opfer derber Scherze der Hofleute. Im Verlauf des 18. Jahrhunderts und unter dem Einfluss der Aufklärung erfuhr diese komische Institution daher zunehmende Kritik, bis der Hofnarr schließlich an Bedeutung verlor und wieder von der Bühne verschwand.
Lutz Ellrich (Köln)
Das Recht der Komödie
Mit der attischen Komödie institutionalisiert der Stadtstaat Athen im 5. Jahrhundert v. Chr. eine merkwürdige Selbstbeobachtung der Gesellschaft. Während die dreigliedrige Tragödie (nur eine einzige ist vollständig überliefert) am Ende stets die Heilkräfte der Polis feiert und den gescheiterten Heroen als überwundenen Gestalten der Vorgeschichte Achtung erweist, operiert die Komödie auf der Höhe der Gegenwart. Indem sie das hier und jetzt politisch Erreichte durch den Vergleich von Anspruch und Wirklichkeit befragt, die bestehende Ordnung mithilfe künstlicher Turbulenzen zu erschüttern sucht und nicht zuletzt das herrschende Rechtssystem, dessen streitschlichtende Leistung die Athener geradezu exzessiv nutzten, rückhaltlos ausleuchtet, testet die Komödie – nicht allein im vorgeführten Spiel, sondern auch durch ihr eigenes Vorkommen als ein öffentliches, nicht zu unterdrückendes Ereignis – die Robustheit der Demokratie. Ihr Existenzrecht tritt dort am Hellsten zu Tage, wo sie die dunklen Seiten des Rechts zum Vorschein bringt und die Zuschauer teils mit utopischen, teils mit reaktionären Lösungen konfrontiert. – Im Vortrag soll aber nicht nur die griechische Komödie behandelt werden. Auch historisch spätere Beispiele für die Komödie des Rechts stehen in gebotener Kürze zur Diskussion.
Tom Kindt (Göttingen)
Wo der Spaß aufhört ... Zur Institutionalisierung des Komischen in
Komödien um 1800
Im zurückliegenden Jahrhundert hat sich die enge Verschränkung von Komödien- und Komikforschung, die für beide Bereiche seit der Antike prägend gewesen ist, nach und nach aufgelöst. Komödienforschung ist nun zumeist Gattungsgeschichte ohne größeres Interesse an komiktheoretischen Debatten. Und in der Komikforschung findet die Komödie kaum noch Beachtung. Für diese Entwicklung gibt es gute Gründe, sie hat zugleich jedoch zur Vernachlässigung einiger Fragestellungen geführt, die für die Beschäftigung mit der Komödie und dem Komischen gleichermaßen wichtig sind. Der Vortrag soll einer dieser Fragestellungen nachgehen; er widmet sich der Komödie als Institutionalisierungsform von Komik und dem Komischen unter den Bedingungen mehr oder weniger starrer Inszenierungsvorgaben. Vor dem Hintergrund einiger Hinweise zu den Begriffen "Institution", "Komödie" und "Komik" soll die Institutionalisierung des Komischen in der Komödie anhand von Lustspielen Lessings, Goethes und Kotzebues beispielhaft untersucht werden.
Christian F. Hempelmann (Champaign, IL, USA) / Andreas Waschbüsch (München)
Wenn Kirche komisch sein will
Dieser Vortrag will zeigen, welche Funktionen und Formen Humor im Kontext der Institution Kirche annehmen kann. Leitende Perspektive ist dabei der (scheinbare) Gegensatz zwischen Humor und Heiligem. Auf der Grundlage einer Übersicht über die Geschichte der - ursprünglich weitgehend negativen - Position der Kirche zum Humor, wird gezeigt, was christlichen Humor, also speziell Humor im Dienst von, aber auch Humor über, Glauben und Kirche, heute umfasst. Aktuelle Beispiele sind die Themen in der "folksonomy" Kategorie "Christian jokes" und vor allem Themen und komische Mechanismen in den Sprüchen auf Anzeigetafeln amerikanischer Kirchen.
Christian Maintz (Hamburg)
Die Neue Frankfurter Schule – Hochkomik als Institution?
In einem Land, dessen Rezensenten etwa die Gedichte eines Christian Morgenstern als „Lallen des Deliriums“ und „Hirnschwund-Aphasie“ werteten, hatten es die komischen Künste lange schwerer als andernorts. Den Autoren und Zeichnern der „Neuen Frankfurter Schule“ kommt das historische Verdienst zu, hier einen Paradigmenwechsel befördert und das Komische innerhalb des literarischen bzw. hochkulturellen Feldes etabliert zu haben. Im Zuge und Dienste dieser Entwicklung haben sie verschiedene Institutionen gegründet (z.B. das Satiremagazin Titanic), auch sind ihnen Institutionen gewidmet worden (so das Frankfurter „Museum für Komische Kunst“) – inzwischen stellen sie wohl gar selbst eine Institution bzw. eine Instanz dar. Stimmt das? Und wenn ja: ist es schlimm?
Nelly Feuerhahn (Paris)
Die satirische Presse und die Institutionalisierung des komischen Bildes in Frankreich
Obwohl die Zensur die satirische Presse oft in Schranken gehalten hat, wurden seit ihren Anfängen im 19. Jahrhundert viele Gerichtsprozesse gewonnen. Dies zeugt davon, wie wichtig für die Franzosen das demokratische Recht der Freiheit geworden ist, sich über soziale oder politische Zustände lustig zu machen. Heutzutage besitzt die satirische Presse einen gesetzlichen Status, der es ihr erlaubt, die Ereignisse der Gegenwart lächerlich darzustellen.
Die wichtigen Momente der Geschichte der grafischen Satire werden anhand der besten Vertreter aus dem Zeitschriftenbereich vorgestellt und ihre sozio-politischen Merkmale betont: La Caricature und Le Charivari; L’Assiette au beurre; Le Canard enchaîné; La Baïonnette; L’Os à moelle; Hara-Kiri; Charlie-hebdo und der vor kurzem gegründete Siné-Hebdo.
Sa / 21. Februar / 10 bis 13 Uhr
Uwe Wirth (Gießen)
Komik-Zeiten
In meinem Vortrag soll es um die institutionellen Grenzen des Komischen in zeitlicher Hinsicht gehen. Wer bestimmt, wann gelacht werden darf?
Historisch betrachtet ist der Karneval eine der wichtigsten Institutionen des Komischen: Während der sogenannten "fünften Jahreszeit" darf potentiell überall gelacht werden - allerdings nur im Rahmen einer streng definierten Zeitspanne: vom 11.11. bis zum Aschermittwoch. Die Definitionshoheit für diese Zeit der Kollektiv-Komik hatte jahrhundertelang die katholische Kirche eine Institution, die sich als Wegweiserin für das ewige Leben auch das Recht nahm, die diesseitige Lebenszeit der Gläubigen zu strukturieren. In seinem Aufsatz "Frames of comic 'freedom'" vertritt Umberto Eco die These, der "religiöse Karneval" sei primär zeitlich begrenzt, dermoderne "Massenkarneval"
zeichne sich dagegen durch räumliche Begrenzungen aus. Ich möchte diese These mit Blick auf jene Institutionen diskutieren, die heute unser diesseitiges Leben strukturieren: Die Massenmedien und die Wirtschaft. Wie definieren sie die zeitlichen Grenzen des Komischen?
Karin Knop (München)
TV-Comedy in Deutschland – Auch eine Institution der Medienkritik?
Seit den neunziger Jahren, also in dem Zeitraum, in dem sich die Programmplanung nach kommerziellen Kriterien durchsetzte, hat sich das eigene Medium als zentrales Thema in Comedyangeboten des deutschen Fernsehens etabliert. Innerhalb dieser Entwicklung ist die humoristisch-selbstreferentielle Medienkritik fester und expandierender Bestandteil des Programmalltags geworden. Die Kritik bezieht sich dabei auf die unterschiedlichen Präsentationsebenen oder Sendungsinhalte des Fernsehens, aus welcher komisches Kapital geschlagen wird.
Neben einer Strukturierung der existierenden medienkritischen Dimensionen des Comedy-Genres und allgemeinen Informationen zum medienkritischen Gehalt von TV-Comedy werden detaillierten Analysen der Medienkritik innerhalb der Harald Schmidt Show und TV Total vorgestellt.
Rolf Lohse (Göttingen)
Harald Schmidts Komik „dritten Grades“
Harald Schmidt – mittlerweile eine Institution des deutschen Fernsehens – verwendet komische Verfahren von erstaunlich unterschiedlicher Qualität. Dialoge mit schlagfertigen Repliken wechseln ab mit eingespielten oder „life“ vorgeführten Sketchen. Er verwendet herkömmliche Witze, Witze, die raffiniert auf die eigene Strukturierung (Pointenstruktur) oder die mediale Einbettung weisen und nur durch diese Verweise wirken und er verwendet bisweilen eine besondere Art von Witzen oder vermutlich komisch gemeinten Gesten, bei denen Zweifel aufkommen, ob und auf welche Weise sie als komisch verstanden werden können. Es soll hier die Hypothese diskutiert werden, daß Harald Schmidt absichtsvoll auf Momente der Unentscheidbarkeit zielt, bei denen nicht mehr klar ist, welches die angemessene Reaktion ist – Lachen oder Empörung. Schmidt scheint es nicht auf einen Witz (Komik ersten Grades) oder eine erhellende Einsicht in die Machart oder Präsentationsweise von Komik (Komik zweiten Grades) abgesehen zu haben, sondern auf die Verunsicherung hinsichtlich dessen, wie denn nun das gemeint sei, was er vorführt oder vorträgt. Diese Herstellung von Unentscheidbarkeit könnte nun als „Komik dritten Grades“ bezeichnet werden, mit der die Bewertungsmaßstäbe und die Transgressionstoleranz der Rezipienten einem „Stresstest“ unterzogen werden. Ein solcher Stresstest ist nicht nur für den Probanden prekär, er kann auch für den Initiator heikel werden. Damit ist ein Feld für komische Interaktionen eröffnet, bei dem es nicht mehr um die komische Sache oder um die Machart dieser Sache geht, sondern um die Art und Weise, wie die an der komischen Kommunikation Beteiligten sich über die Bewertung dessen einigen, was da vorgeführt wird.
Eine solch komplexe Funktionalisierung komischer Verfahren schließt die übliche Verfahren nicht aus, sie setzt aber ganz eigene Akzente, die möglicherweise erklären, warum ihm sein Publikum seit Jahren die Treue hält. |